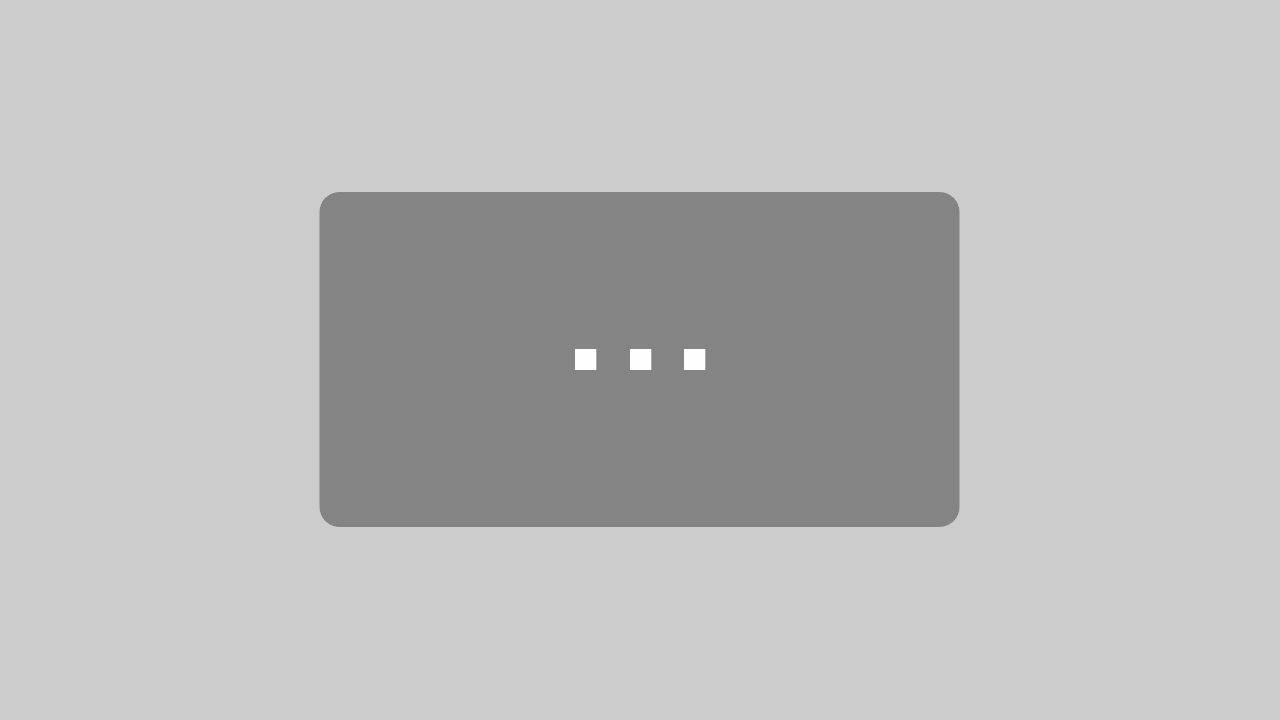Es kommt häufig vor, dass Vermieter an ihrem Mietobjekt Überwachungskameras anbringen möchten.
Soweit ausschließlich der private (also nicht vermietete) Bereich des Vermieters erfasst wird, ist dies in der Regel unproblematisch.
Etwas anderes kann aber gelten, wenn durch die Installation einer Videoüberwachung Teile von Gemeinschaftsflächen wie Hausflur, Hauseingang, Garten, Zufahrt, Parkplätze oder sogar das Nachbargrundstück erfasst werden.
Inhalt
Zulässigkeit der Videoüberwachung durch den Vermieter
Die rechtlichen Vorgaben zur Videoüberwachung sind eher restriktiv, da hierdurch grundsätzlich in das Recht einer Person auf informationelle Selbstbestimmung eingegriffen wird. Der Betroffene (Mieter, Besucher) kann nämlich nicht mehr kontrollieren, was im weiteren Verlauf mit seinen personenbezogenen Daten geschieht. Dabei spielt es keine Rolle, durch welche Art von Gerät (Kamera, Smartphone, Drohne, Wildkamera, Dashcam, usw. die Überwachung erfolgt.
Auf der anderen Seite ist jedoch zu beachten, dass die Sicherheit im Wohnbereich hat für Vermieter und Mieter gleichermaßen an Bedeutung gewonnen hat. Vermieter haben insbesondere im Hauseingangsbereich, Hausfluren, Fahrstühlen und Tiefgaragen Videoüberwachungsanlagen installiert, um ihren Mietern und deren Besuchern ein besseres Sicherheitsgefühl zu geben.
Sie können vom Mieter im Einzelfall eine Einwilligung zur Videoüberwachung einholen. Dies ist aber unpraktisch, da solche Einwilligungen einseitig widerrufen werden können und bei einem Mieterwechsel neu eingeholt werden können. Zudem ist der Vermieter beweisbelastet, dass eine solche Einwilligung vorliegt.
Für die Frage der Zulässigkeit einer Videoüberwachung im nichtöffentlichen privaten Bereich ist ansonsten Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO einschlägig.
Danach ist eine Videoüberwachung zulässig, wenn die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen (hier: der die Kamera nutzende Vermieter) erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte der betroffenen Person (andere Mieter und dritte Personen) überwiegen.
Es muss daher jeweils im Einzelfall eine Rechtsgüterabwägung zwischen Eigentumsgrundrecht, Überwachungsinteresse und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht stattfinden. Die zulässige Videoüberwachung kann sich dabei in der Regel bei fehlender Zustimmung einer Mietpartei (bzw. widerrufener Einwilligung) nur bei konkret zu befürchtenden Gefahren ergeben.
Was sagt die Rechtsprechung?
Beispielhaft führt das AG Neukölln mit Urteil vom 16.07.2014 (Az. 20 C 295/13) aus:
“Der Kläger hat einen Anspruch gegen die Beklagte auf Beendigung der Videoüberwachung und Beseitigung der Videokameras im Treppenhaus analog § 1004 Abs. 1 BGB i. V. m. Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG.
- Vermietertipp: Sie sind sich als Vermieter unsicher, was Sie tun dürfen? Dann kontaktieren Sie unsere Mietrechtsexperten, die Ihnen beratend zur Seite stehen – als Mitglied im Vermieterverein e.V. ist die telefonische Beratung ab der Basisklasse für Sie kostenfrei (hier Mitglied werden).